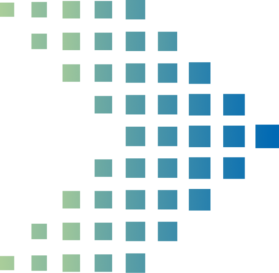Österreich ist Kosten-Weltmeister – bei den Arbeitskosten an der OECD-Spitze, bei der Wettbewerbsfähigkeit im Hintertreffen. Warum wir bei Lohnabschlüssen dringend umdenken müssen. Ein Kommentar von IV-Geschäftsführer Simon Kampl.
Warum wir bei den Lohnabschlüssen endlich umdenken müssen

Österreich steht im internationalen Vergleich an einer gefährlichen Spitze: Mittlerweile haben wir die höchsten Arbeitskosten in der gesamten OECD – rund 110.000 Dollar pro Arbeitnehmer und Jahr.
Standortrisiko!
Auf den ersten Blick mag das nach Wohlstand klingen – in Wahrheit ist es ein Standortrisiko. Denn wir sind bei den Kosten vorne, aber bei Produktivität und Wachstum schon lange nicht mehr.
Besonders deutlich zeigt sich dieses Spannungsfeld bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Der jüngste Abschluss in der Metallindustrie ist dafür ein gutes Beispiel:
- Die Ist-Löhne steigen um 1,41 Prozent, die KV-Gehälter um zwei Prozent.
- Zusätzlich gibt es 1.000 Euro Kaufkraftsicherungsprämie oder Freizeitoptionen.
- Für 2026 sind weitere, zumindest moderate Erhöhungen fixiert.
Das Ergebnis wird vielfach als „vernünftig“ bezeichnet. Und ja – es ist im Vergleich zu früheren Runden ein Abschluss mit Augenmaß. Aber er offenbart auch die Grenzen des bisherigen Systems. Denn die Logik bleibt dieselbe: Lohnerhöhungen orientieren sich an der Inflation.
Genau hier liegt das Problem
Denn die österreichische Inflation ist nicht nur deutlich höher als im Euroraum, sondern sie wurde in den letzten Jahren zudem überwiegend nicht durch die Industrie verursacht. Sie wurde vor allem auch durch den Dienstleistungssektor verursacht – Gastronomie, Freizeit, Wohnen, teilweise auch Energie und Mobilität. Trotzdem muss die Industrie diese Teuerung über höhere Löhne kompensieren. Von 2011 bis heute stiegen die Preise in der österreichischen Gastronomie Beispielsweise um 29 Prozent über dem Euro-Durchschnitt. Mit anderen Worten: Die produktive Wirtschaft zahlt für eine Kostenentwicklung, die sie selbst zu einem großen Teil nicht ausgelöst hat. Das wäre weniger dramatisch, wenn die Unternehmen gleichzeitig hohe Margen und stabile Nachfrage hätten. Aber die Realität ist eine andere: Wir stecken im dritten Rezessionsjahr – Investitionen brechen ein, und die internationale Konkurrenz schläft nicht. Wer heute in Österreich investiert, muss Kosten tragen, die im internationalen Wettbewerb kaum noch darstellbar sind.
Hinzu kommt die Abgabenlast
Österreich finanziert den größten Sozialstaat der OECD: Über 31 Prozent des BIP fließen in Sozialausgaben. Das ist an sich eine Errungenschaft, doch der Preis dafür ist die höchste Steuer- und Abgabenbelastung auf Arbeit. Für die Unternehmen bedeutet das noch höhere Lohnnebenkosten, für die Beschäftigten einen schwachen Anreiz zur Mehrarbeit, weil netto oft zu wenig übrig bleibt. Die Folge: Die Arbeitskosten schießen nach oben, die Wettbewerbsfähigkeit nach unten. Schon heute verlagern Unternehmen Investitionen oder Kapazitäten dorthin, wo die Rahmenbedingungen günstiger sind. Das ist eine stille Erosion von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen; mit Folgen, die wir jetzt schon spüren: So sind in Österreich seit 2019 netto rund 74.000 Industriejobs verloren gegangen.
Deshalb braucht es ein Umdenken:
- KV-Abschlüsse mit Maß und Ziel, die nicht automatisch die Inflation eins zu eins abbilden, sondern Produktivität, Marktbedingungen und Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigen.
- Steuern und Abgaben auf Arbeit runter, damit sich Leistung und Mehrarbeit wieder lohnen.
- Politische Reformen, die Bürokratie abbauen, Energie leistbar machen und den Standort stärken.
Die Sozialpartnerschaft hat mit dem letzten Abschluss gezeigt, dass Vernunft möglich ist. Aber wenn wir weiter auf dem alten Pfad der reinen Inflationsanbindung bleiben, steuern wir in eine Sackgasse. Nur mit realitätsnaher Lohnpolitik und spürbaren Entlastungen bleibt Österreich ein attraktiver Industriestandort – und damit ein Land, das Arbeitsplätze sichert und Zukunft schafft.